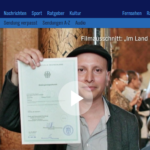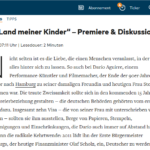Vita – Darío Aguirre
Darío Aguirre wuchs in Ecuador auf und war dort als Maler, Musiker und Performancekünstler tätig. 1999 ging er nach Deutschland und studierte von 2001-2008 Visuelle Kommunikation/Medien an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HfbK). 2004-2013 organisierte er das Kurzfilmfestival „ambulart” in Deutschland, Ecuador und Mexiko. Lebt und arbeitet als freier Autor, Cutter und Regisseur in Hamburg.
Filmografie
- Im Land meiner Kinder | Dokumentarfilm | 88 min | 2018
- Cesars Grill | Dokumentarfilm | 88 min | 2013 | Trailer ansehen…
- Five Ways to Darío | Dokumentarfilm | 80 min | 2010 | Trailer ansehen…
- Schlaflied für einen Rückkehrer | Dokumentarfilm | 15 min | 2007 | Trailer ansehen…
- Mein letzter Tag als fiktiver Mensch | Dokumentarfilm | 10 min | 2006 | Trailer ansehen…
„Im Land meiner Kinder“ – ein Gespräch mit Darío Aguirre
Die Einladung die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, war der Auslöser für Dein neues Filmprojekt „Im Land meiner Kinder”. Welche Gedanken gingen Dir als erstes durch den Kopf, als Du den Brief gelesen hast?
Dario Aguirre: Ich weiß es noch ganz genau. Nachdem ich den Brief geöffnet hatte, habe ich erst einmal gelächelt. Und gleichzeitig empfand ich eine Art Melancholie, eine Mischung aus ‚Na, endlich!‘ und der Erkenntnis, dass der Weg dahin nicht leicht war. Und obwohl mir bewusst ist, dass meine Geschichte viel unkomplizierter ist als die von vielen anderen, musste ich trotzdem sofort an die Anfangszeit denken, wieder und wieder. Man kann es mit einer Situation vergleichen, in der man eine Diagnose erhält, die das ganze Leben verändert. So ein einschneidendes Ereignis bringt Menschen dazu, über ihre Vergangenheit nachzudenken. Für mich war es spannend zu rekapitulieren, was in den 15 Jahren alles passiert ist. Es war also nicht nur eine Einladung, endlich dauerhaft bleiben zu dürfen, sondern auch eine Einladung, inne zu halten und zu reflektieren.
Kam dieser Brief überraschend für Dich?
DA: Total überraschend. Wenn Du daran gewöhnt bist, dass Dein Visum immer auf der Kippe steht und alle zwei Jahre verlängert werden muss und man nie weiß, ob es klappt, hört man auf langfristig zu denken oder zu planen. Man erwartet fast schon abgelehnt zu werden. Die Gefahr besteht immer, aber man gewöhnt sich über die 15 Jahre daran. Es war eine tolle Überraschung, aber gleichzeitig dachte ich auch, dass es einen Haken geben muss. Wenn Du über Jahre eine schlechte Beziehung führst und plötzlich kommt dieser Mensch und will dich heiraten, dann fragt man sich schon warum. Es gibt einen bittersüßen Beigeschmack. Und diesen Konflikt wollte ich mir genauer anschauen und natürlich war ich auch sehr neugierig, wie der Einbürgerungsprozess vor sich geht. Es hätte auch immer noch passieren können, dass ich abgelehnt werde, weil ich vielleicht nicht alle Bedingungen erfülle. Ich habe natürlich alles getan, damit es klappt, aber im Grunde war es wieder nur eine Bewerbung für einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland.
Was waren für Dich die größten Herausforderungen in den letzten Jahren und wie haben sie Dein Leben geprägt?
DA: Auf der einen Seite erlebt man eine große Verunsicherung, da man nie weiß, wie lange man bleiben und deshalb auch nicht langfristig planen kann. Gleichzeitig gibt es viele alltägliche Anforderungen, die man verstehen und klären muss. Ich konnte nur sehr wenig Deutsch am Anfang, weshalb die Sprache für mich die größte Hürde war. Gleichzeitig musste ich mich an die kulturellen Unterschiede gewöhnen. Ich war schon ziemlich durch den Wind. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man sich neu erfinden muss. Man kann nicht einfach weiter machen wie im Heimatland. Man muss eine Balance schaffen zwischen den Dingen, die man behalten möchte und den Erwartungen, die an einen gestellt werden. Dadurch hatte ich oft das Gefühl, gegen den Strom schwimmen zu müssen, um ans Ziel zu kommen und auch gegen mich selbst ankämpfen zu müssen. Man muss sich von seinem Ego verabschieden, um Platz für Neues zu schaffen. Deswegen war es für mich auch so interessant, meinem ersten Jahr in Deutschland noch einmal nachzuspüren und davon zu erzählen. Ich habe die erste Zeit in Deutschland als großen Bruch erlebt, bei dem man nicht weiß, ob man es schaffen wird. Wenn man dann seinen Platz findet – und bei mir war es das Studium an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg – kann man sich auch weiterentwickeln. Dann gibt es eine Perspektive und dann wird vieles leichter. Man trifft andere Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben und die Dinge kommen ins Rollen. Der Anfang ist immer das schwerste, weil man innerlich eine große Umstellung vollziehen muss. Noch einmal darüber zu reden und die Menschen zu treffen, die mich damals begleitet haben – wie zum Beispiel meine jetzigen Schwiegereltern – war für mich sehr wichtig. Ich wollte verstehen, wie sie die Situation damals erlebt haben, denn es geht ja immer um beide Seiten. Von diesen beiden Perspektiven lebt der kulturelle Austausch und diesen Aspekt wollte ich auch unbedingt im Film haben. Ein gelungenes Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn sich beide Seiten verstehen.
Habt ihr erst jetzt so richtig über deine Anfangszeit gesprochen?
DA: Ja, wir haben tatsächlich nach 15 Jahren zum ersten Mal ehrlich darüber reden können. Auch weil ich mich jetzt besser verständlich machen kann. Damals ging das noch nicht. Ich konnte mich zum ersten Mal auch emotional ausdrücken und mich ihnen ganz anders nähern.
Mittlerweile lebst Du mit Deiner Familie in Hamburg, arbeitest als Filmemacher und hast die Balance, die Du angesprochen hast, augenscheinlich gut im Griff. Es wirkt so, als ob du „angekommen” bist. Wie würdest Du Dein Verhältnis zu Deutschland beschreiben?
DA: Obwohl ich hier meinen Platz gefunden und viele Freunde habe, merke ich im Vergleich zu meinen Kindern trotzdem einen Unterschied, weil ich in einem anderen Land gelebt habe und Erinnerungen daran besitze. Die werden nie vergehen. Meine ecuadorianische Seite wird nie verschwinden. Meine Kinder wachsen hier auf, aber vielleicht werden sie eines Tages die Gegenrichtung einschlagen und nach Ecuador gehen, wer weiß. Aber ich lebe permanent eine Art Doppelleben. Ich weiß immer was dort los ist und wenn Menschen sterben, erkenne ich, wie viel ich von ihrem Leben verpasse. Damit muss ich mich abfinden. Wichtige Ereignisse erlebt man nur aus der Distanz. So zum Beispiel als ich Vater wurde. Mein Vater lebt 14.000 Kilometer entfernt und ich musste ihm per Skype von der Geburt meiner Kinder erzählen. Gleichzeitig bin ich bei Besuchen in Ecuador die erste Woche immer total gestresst und will spätestens nach einem Monat wieder zurück nach Deutschland. Wenn ich dort bin, habe ich absolut das Gefühl, dass hier in Hamburg mein Platz ist. Wobei es eigentlich noch nicht einmal Hamburg ist, sondern vielmehr mein Stadtviertel… Ein Zuhause ist, glaube ich, viel kleiner als ein Land. Ich kann nicht sagen, dass ich mich in Deutschland wohl fühle. Ich kenne ja noch nicht einmal alles – Altona ist mein Viertel, auf Spanisch sagt man Barrio und in Ecuador habe ich mich auch in meinem Barrio zuhause gefühlt. Mehr brauchte ich nicht.
Im Film taucht auch Mariuxi Guevarra auf, die ebenfalls aus Ecuador stammt und mit der du bei einem deiner Kurzfilme schon zusammen gearbeitet hast. Warum hast Du sie dazu geholt?
DA: Ich finde an Mariuxi besonders interessant, dass sie immer wieder über ihre Erfahrung reflektiert hat und sich sehr für Ethnologie interessiert. Wir haben uns an der HfbK kennengelernt und hatten immer sehr gute Gespräche über das Fremdsein, aber auch über ganz alltägliche Sachen, wie die Visums-Verlängerung. Das ist sehr typisch zwischen Ausländern und manchmal lacht man auch zusammen darüber. Aber es taucht als Gesprächsthema immer wieder auf. Oft ist die erste Frage: ‚Und was macht das Visum?‘ Bei meinem Kurz-Dokumentarfilm „Mein letzter Tag als fiktiver Mensch” war sie eine der Protagonistinnen. Für mich ist Mariuxi eine Art Alter-Ego. Sie kommt auch aus Ecuador, lebt fast so lange wie ich in Deutschland und wir sind beide sehr ähnliche Wege gegangen. Sie wurde allerdings schon zwei Jahre vor mir eingebürgert. Sie hatte die Erfahrung also früher als ich und ich hoffte, sie könnte mir ein paar Tipps geben, wie es ihr danach ging. Sie war eine Art Zukunftsvision für mich.
In Deinen Filmen benutzt du immer wieder Animationssequenzen, um die Dinge zu zeigen, für die es keine Bilder gibt. Wie konzipierst Du diese Sequenzen?
DA: Ich hatte für bestimmte Situationen, die ich erzählen wollte, keine Bilder. Gleichzeitig sollten diese Bilder nicht klar und eindeutig sein, weil die Erinnerungen für mich mittlerweile auch etwas schwammig und diffus waren. Wir haben dann mit Hilfe der Rotoskopie aber auch durch Zeichnungen, die etwas verwischt und eher aquarellig wirken, einen Weg gefunden, um dieses Gefühl einer unklaren Erinnerung auszudrücken. Mir war dabei wichtig, dass die Animation eine bestimmte Funktion hat, nämlich die Verarbeitung von Vergangenheit. Sie erzählt von meiner schmerzhaften Anfangszeit in Zittau und deshalb konzentrieren sich die animierten Passagen auch auf diese Zeit. Für die Zusammenarbeit mit dem Zeichner Victor Orozco haben wir die Szenen erst real gefilmt. Danach habe ich die Szenen geschnitten und erst dann hat Victor sie mit der Rotoskopie-Technik bearbeitet. Für mich war dabei besonders wichtig, dass die Animation dazu dient, bestimmte Ereignisse zu verarbeiten, so wie ich es früher mit der Malerei gemacht habe.
Die Animation hat aber auch etwas sehr selbstironisches…
DA: Ja, sie musste eine gewisse Absurdität vermitteln, weil sie einen Zustand zwischen Erinnerung und Traum beschreibt. Für mich sind Erinnerung und Traum sehr verwandt. Man kann auch in der Erinnerung neue Sachen dazu erfinden.
Du hast für die Kamera Helena Wittmann – ebenfalls Filmemacherin – engagiert, die sehr schöne, streng komponierte Bilder für „Im Land meiner Kinder“ eingefangen hat. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
DA: Ich kenne Helena aus meiner Zeit an der Hochschule. Aber damals haben wir noch nicht zusammen gearbeitet. Mir hat vor allem ihr Film „Wildnis” sehr gefallen. Das Szenario und die Einrichtung haben mich sehr an Zittau erinnert und vielleicht hat mich das so angezogen. Helena kann sehr gut beobachten. Sie ist in der Lage, die Räume – genauso wie die Menschen – als Protagonisten zu behandeln. Für mich ist es wichtig, dass die Umgebung Teil der Inszenierung ist. Und Helena hat mit ihren eigenen Filmen gezeigt, dass sie das genauso sieht. Sie hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wo sie sich mit der Kamera positionieren muss, um die Situationen bestmöglich einzufangen. Und gleichzeitig ist es unglaublich angenehm mit ihr zu arbeiten. Sie gibt allen Beteiligten ein sehr gutes Gefühl. Das ist wirklich ein Geschenk.
Wie lange habt ihr gedreht?
DA: Mit dem Team haben wir über fast drei Jahre verteilt immer mal wieder gedreht. Die persönlicheren Passagen habe ich allerdings selbst gedreht, wie die Gespräche mit meinen Schwiegereltern, aber auch bei mir zu Hause mit Stephie. Das hatte damit zu tun, dass ich eine Intimität erreichen wollte, die unmöglich ist, wenn noch ein Ton- und ein Kameramann dabei sind.
Du hast Dich entschieden Deutscher zu sein, aber zu Hause zelebriert ihr euer kleines Lateinamerika…
DA: Für uns ist es total normal, aber von außen wirkt es vielleicht ungewöhnlich, obwohl ich eine ganze Reihe von Menschen kenne, die noch lateinamerikanischer Leben als wir. Wir reden spanisch zu Hause und ich esse immer noch gebratene Kochbananen zum Frühstück. Wir reden spanisch, weil Stephie und ich uns in dieser Sprache kennengelernt haben. Sprache hat sehr viel mit Emotion zu tun und wenn man sich in einer Sprache kennengelernt hat, bleibt man auch dabei, alles andere klingt konstruiert. Mit den Kindern sprechen wir auch spanisch. Ich finde es toll, immer wieder zu erleben, dass unsere Kinder viel mehr können, als wir denken. Sie sprechen spanisch und deutsch und werden noch weitere Sprachen lernen. Ich mache mir keine Sorgen, dass sie schlecht deutsch lernen, sondern denke, dass sie viel mehr Sprachen als nur Deutsch sprechen werden. Mein Deutsch wird nicht mehr besser, aber die Zukunft sind die Kinder. Sie werden all die Ängste überwinden, die die Politik vorbringt: dass man zu Hause nur deutsch reden sollte, weil die Kinder es sonst nicht lernen. Ich glaube Bildung hängt von viel mehr Sachen als dem reinen Lernprozess ab. Man erreicht bei einem Kind viel mehr durch Nähe und Spiele. Wenn die Atmosphäre stimmt, kann ein Kind alles erreichen. Meine Erfahrung als Vater gibt mir Hoffnung, weil unsere Kinder es schaffen meine alten Strukturen aufzubrechen und mich immer wieder zu überraschen. Und wenn ihnen das gelingt, werden sie es auch im großen gesellschaftlichen Zusammenhang schaffen. Sie werden auch dort Dinge verändern und das ist eine schöne Vorstellung.